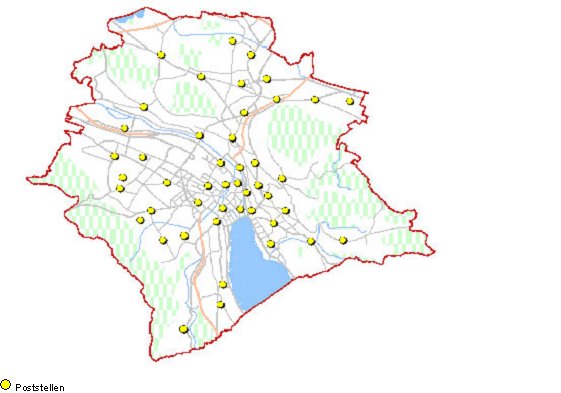|
Name |
Jahreszahlen und Ereignisse der Postgeschichte Zürichs
|
| |
|
|
|
|
Abbildung |
 |
|
Bildtext |
Zürcher Standesläufer im 15. Jahrhundert. |
|
Bildquelle |
Ansichtskarte |
| |
|
|
|
|
International |
|
Schweizweit |
| |
Zürcher Postwesen |
| |
|
|
Mittelalter |
Es gab noch kein staatlich
organisiertes Postwesen und der Grossteil der Bevölkerung war weder des Lesens
noch des Schreibens kundig. Briefe stammten in jener Zeit meist von Regierungen,
Kaufleuten oder Klöstern und waren auch wiederum meist für solche bestimmt. So
musste von Fall zu Fall und in eigener Regie ein Fussbote oder ein Bote zu Pferd
organisiert werden. |
|
|
1610 |
Eröffnung des ersten
Zürcher Posthauses durch die Gebrüder Hess im "Haus zum roten Gatter" an der
Münstergasse Nr. 23. Standort der Hauptpost bis 1762 anschliessend
Standortaufgabe. |
|
1695 |
Der angeblich älteste
Poststempel der Schweiz wird in Genf verwendet.
Das älteste bekannte Schreiben wurde am 15. August 1695 mit diesem Poststempel
gekennzeichnet. Es handelte sich um einen einfachen Leistenstempel "DE GENEVE".
Vermutlich blieb dieser Stempel bis 1699 im Einsatz. |
|
1699 |
Auf Veranlassung der
Marquis de Louvois, Generalintendant der königlichen französischen Posten, wird
in Genf das erste Postbüro eröffnet. Dies nach einer Intervention des
französischen Königs Ludwig XIV bei der Regierung der Republik Genf. |
|
1670 |
Die Zürcher und St. Galler
Kaufmannschaften eröffnen in Genf eigene Postbüros |
|
1675 |
Die Fischer-Post von Beat
Fischer eröffnet ein bernisches Postbüro in Genf |
|
1735 |
Zwischen Bern und Zürich
entsteht die erste Postwagenkurslinie |
| |
1762 |
Der Stand Zürich erklärt
das Postwesen als Staatsregal. |
| |
1762 |
Umzug der Hauptpost in das
zweite Zürcher Posthaus in die Liegenschaften "Haus zum Schäppeli" und "zum
grauen Mann" an der Münstergasse 17 und 19. Standort bis 1838 aktiv. |
|
1798 |
Aus der alten
Eidgenossenschaft entsteht der Helvetische Einheitsstaat. |
|
1798 |
Einführung des
französischen Feldpostsystems mit 10 mobilen Feldpost-Divisionsbüros |
| |
1830 |
Zürich verfügt bereits
über 88 wöchentlich abgehende und ankommende Postwagenkurse. |
| |
1833 |
Mit der Neumünster-Post
am Kreuzplatz wird in Zürich die erste Poststelle eröffnet |
| |
1835 |
Der bekannte Architekt
Hans Konrad Stadler (1788-1846) wird am 10. November 1835 beauftragt, ein neues
Oberpostamt an der heutigen Poststrasse zu errichten. |
| |
1837 |
Enge erhält seine erste
Poststelle im Hause von Herrn Mathias Koller an der Ecke Beder- / Grütlistrasse
und wechselte seither im Laufe der Zeit mehrmals ihr Domizil. |
| |
1837 |
Das Oberpostamt Zürich
errichtet in der Gemeinde Unterstrass eine Poststelle.
Die Zustellung für die Gemeinden Unterstrass und bis 1853 auch für Oberstrass
erfolgt neu von dieser neu eröffneten Poststelle Unterstrass aus. |
| |
1838 |
Umzug der Hauptpost am 31.
Weinmonat (Oktober) 1838 in das dritte Zürcher Posthaus in den "Zentralhof" an der
Poststrasse. Beibehaltung des Standortes bis 1873. |
|
1840 |
In Grossbritannien
erscheinen die ersten Briefmarken der Welt |
|
1840 |
Um einen Brief von Genf
nach Romanshorn zu senden durchlief die Sendung noch sechs autonome
Postverwaltungen, die allesamt Gebühren erhoben. Seinerzeit kostete eine solche
Sendung noch mehr als ein Brief von Genf nach Istanbul. |
|
1843 |
Der Stand Zürich lädt zur
Schweizerischen Postkonferenz mit 16 Postverwaltungen. |
| |
1843 |
Am 1. März 1843 erschienen
die ersten Briefmarken der
Schweiz. Die Marken Zürich 4 und Zürich 6 der Postdirektion des Standes Zürich.
Nach Grossbritannien war die Schweiz der zweite Staat weltweit mit eigenen
Briefmarken. |
|
1843 |
Erste Briefmarken der
Schweiz Doppel-Genf |
| |
1843 |
Der Personalbestand des
Oberpostamtes Zürich beträgt 64 Personen und verfügte bereits über Büros in
Aussersihl, Enge, Neumünster und Unterstrass. Alleine für die Gemeinden
Hottingen und Fluntern war seinerzeit noch ein einzelner Briefträger zuständig. |
|
1845 |
Das Basler-Tüübli
erscheint als Marke |
|
1847 |
Eröffnung der Bahnstrecke
Zürich-Baden am 9. August 1847. |
|
1849 |
Übernahme der Post durch
den Bund am 1. Januar 1849. Aufhebung der
Kantonalposten und Gründung der Bundespost mit 11 Postkreisen und den
zugehörigen Kreispostdirektionen.
Anpassung und Vereinheitlichung der Posttarife auf 1. Oktober 1849. |
|
1849 |
Die Gotthard-Post
beförderte 14'000 Reisende. |
|
1850 |
Am 18. Januar 1850
ermächtigt der Bundesrat die Kreispostdirektionen, für Orte mit regem
Postverkehr, selber Lokalpostmarken herauszugeben. |
|
1850 |
Einheitliche Briefmarken werden in der
ganzen Schweiz eingeführt. Es sind dies die Marken "Ortspost" und "Poste locale"
zu 2½ Rappen und die dreifarbigen "Rayon I" zu 5 Rappen und "Rayon II" zu 10
Rappen. |
|
1850 |
Die Post beförderte 1850
durchschnittlich 16 Millionen Briefe (ca. 7 Briefe pro Einwohner). |
|
1850 |
Ein Brief von Chiasso nach
Basel kostete 20 Rappen; gleichviel wie 3 kg Kartoffeln. |
|
1850 |
Erste Verwendung von
Zusatzstempeln (Vorläufer der Sonderstempel) durch Veranstalter |
|
1850 |
In der Sturmnacht vom 16.
auf den 17. Dezember 1850 versinkt das Dampfschiff Delphin auf dem Walensee. Auf
dem Schiff befanden sich auch Kutsche und Passagiere des Nachtpostkurses von
Zürich nach Chur. |
| |
1850 |
In Zürich gab es bereits
14 Poststellen für 40'000 Einwohnerinnen und Einwohner |
|
1852 |
Vereinheitlichung der
Währung in der ganzen Schweiz auf 1. Januar 1852.
Bis anhin galt 1 Batzen 10 Rappen und 1 Kreuzer 2½ Rappen. |
| |
1853 |
Ein einzelner Briefträger
genügte um das Gebiet der ehemaligen Stadt Zürich zu bedienen. |
| |
1853 |
Eröffnung der Postablage
Oberstrass am 1. Juli 1853 im Wirtshaus "Linde".
Der Ablagenhalter, in Person des Lindenwirtes Johann Caspar Ziegler, war
zugleich auch als Briefträger tätig. |
| |
1853 |
Es entstehen Postbüros in
Hirslanden, Hottingen, Oberstrass und Riesbach.
Diese Postbüros übernehmen teilweise schon Zustellfunktionen für benachbarte
Gemeinden. Beispielweise wird die Post für Fluntern fortan durch einen eigenen
Briefträger von Oberstrass aus zugestellt. |
|
1854 |
Die berühmte Marke "Basler
Tübli" verliert am 30. September 1854 ihre Frankaturgültigkeit. |
| |
1855 |
Wollishofen erhält ein
Postbüro. |
|
1857 |
Erste Bahnpostwagen werden
eingeführt. Die erste offizielle Strecke wurde am 1. Oktober 1857 von Zürich
nach Brugg von der Nord-Ost-Bahn befahren. |
| |
1857 |
Weitere Postbüros
entstehen in Fluntern, Wiedikon und Wipkingen.
|
|
1858 |
Einführung der
Bahnpoststempel |
| |
1859 |
Die Poststelle Oberstrass
wird verlegt an die Winterthurerstrasse bei der Kirche von Oberstrass. Dieser
neue Standort blieb bis ins Jahre 1862 erhalten. |
|
1860 |
Die ersten separaten
Botentouren für Paket- und Geldmandatzustellungen werden in den Städten Bern,
Basel und Zürich eingeführt. |
|
1862 |
Einführung des
Postanweisungsverkehrs in der Schweiz |
| |
1862 |
Die Poststelle Oberstrass
bezieht den neuen Standort im Schulhaus neben dem Bethaus |
|
1864 |
Die ersten Hotelpostmarken
erscheinen in der Schweiz. Diese dienten zur Frankatur von privat organisierten
Transporten durch den Hotelier, bei fehlender postalischer Erschliessung. Das
Hotel Rigi-Kaltbad verwendete als erstes Hotel diese Marken, ab 1870 auch
Rigi-Kulm. |
| |
1864 |
Die Poststelle Oberstrass
bezieht den neuen Standort an der Winkelriedstrasse 1 |
| |
1866 |
Aufgrund der starken
Zunahme des stadtzürcherischen Verkehrs musste bereits 1866 ein Post- und
Telegraphendienst im Hauptbahnhof eingerichtet werden. Postbüro erst 1872. |
|
1867 |
Erstmals erscheinen
Briefumschläge mit Wertzeicheneindruck der Bundespost |
|
1867 |
Erste "Geldanweisungscartons"
(Postanweisungen) mit eingedruckten Wertzeichen |
| |
1867 |
Eröffnung eines Postbüros
am Limmatquai (spätere Post Mühlegasse). |
|
1868 |
Um das
Abrechnungsverfahren bei der Aufgabe von Telegrammen zu vereinfachen werden
sogenannte Telegraphenmarken eingeführt. Diese bleiben bis 1886 bestehen. |
|
1870 |
Der militärisch
organisierte Feldpostdienst wird eingeführt |
|
1871 |
Bewohner der 1870/71 durch
preussische Truppen belagerten Stadt Paris, errichten mit Gasballons eine
Luftbrücke. Mit ihnen beförderte man um die 11'500 kg Briefpost. Ballonpost als
erste Vorboten der heutigen Luftpost. |
|
1871 |
Portofreiheit für die
86'000 Internierten der Bourbaki-Armee innerhalb der Schweiz und in das
nichtbesetzte Frankreich |
|
1872 |
Nach einem 1871
durchgeführten Probelauf, werden per 21. Dezember 1872 Streifbänder
"Francobanden" eingeführt. |
| |
1872 |
Im Hauptbahnhof wird ein
Postbüro eingerichtet. |
| |
1872 |
Die Poststelle Oberstrass
bezieht den neuen Standort (-1883) an der Universitätsstrasse 33 |
| |
1872 |
Leimbach erhält ein
Postbüro. |
| |
1873 |
Umzug des Oberpostamtes
von der Poststrasse in das vierte
Zürcher Posthaus am Paradeplatz an die Bahnhofstrasse 25.
Der neue Standort wurde bis 1898 als Post genutzt und ist heute der Sitz der Credit-Suisse. |
|
1873 |
Im neuen vierten Posthaus
in Zürich gibt es die ersten Postfächer in Europa, nach amerikanischen Modell. |
| |
1873 |
An der Beatengasse
entsteht ein Transitbüro (bis 1899) |
|
1874 |
Auf Einladung des
Bundesrates und auf Initiative von Herrn Heinrich von Stephan wird am
9. Oktober 1874 der Weltpostverein (UPU) gegründet. Die Gründung fand im Rathaus
des Äusseren Standes in Bern statt. |
|
1874 |
Einführung von Postkarten
mit bezahlter Antwort im Inlandverkehr |
|
1875 |
Am 1. Juli 1875 tritt der
von 22 Staaten unterzeichnete Vertrag des Weltpostvereins in Kraft
|
|
1875 |
Neue Postsendungsarten:
Gerichtsurkunden und Einzugsaufträge |
|
1875 |
Die Gotthard-Post
beförderte 72'000 Reisende. |
| |
1875 |
Im gleichen Jahr wie der
Bau der Uetlibergbahn erfolgte wurde am 1. August 1875 das Grand-Hotel Uetliberg
mit einer eigenen Postablage eröffnet |
|
1876 |
Erster Sonderstempel
anlässlich des "Tir Fédéral" (Eidgenössisches Schützenfest) in Lausanne |
|
1877 |
In der Schweiz finden die
ersten Telefonversuche statt. |
| |
1880 |
Die Private
Zürcher-Telefon-Gesellschaft gründet in Zürich das erste lokale Telefonnetz der
Schweiz. |
| |
1880 |
Eröffnung der Poststelle
Rämistrasse. |
| |
1882 |
Besitzerwechsel des
Grand-Hotels auf dem Uetliberg und der zugehörigen Postablage.
Am 1. Oktober 1882 übernahm der französisch sprechende Alfred Landry den Betrieb
und liess sich eigenmächtig einen Poststempel in französischer Sprache
anfertigen. Während einiger Jahre liess die Postverwaltung den Stempel "Uetliberg
près Zurich" noch dulden. |
|
1884 |
Erstes Patent für eine
Frankiermaschine, blieb jedoch bis 1903 noch erfolglos |
| |
1884 |
Eröffnung der Poststelle
Industriequartier. |
|
1885 |
Einführung von Postkarten
mit bezahlter Antwort für den Auslandsverkehr |
|
1886 |
Die 1868 eingeführten
Telegraphenmarken werden bereits wieder aufgehoben.
Die komplizierte Taxberechnung konnte sich beim Publikum nicht durchsetzen. |
|
1886 |
Das Zürcher Telefonnetz
und die private Gesellschaft wird vom Bund übernommen. |
|
1886 / 87 |
Erster bundeseigener
Postbau wird in St. Gallen gebaut (1919-1977 als Rathaus genutzt). |
| |
1886 |
Die Post Enge befindet
sich von nun an bis 1889 an der Gotthardstrasse 57. |
|
1892 |
Neue Postsendungsart:
Betreibungsurkunden |
| |
1893 |
Erste Eingemeindung von
Zürcher Vororten zur Stadt: Aussersihl, Enge, Fluntern, Hirslanden, Hottingen,
Industriequartier (Aussersihl), Leimbach (Enge), Oberstrass, Riesbach,
Unterstrass, Wiedikon, Wollsihofen und Wipkingen. |
| |
1893 |
Eröffnung Bahnpostbüro
Zürich. |
| |
1896 |
Die Poststelle Oberstrass
bezieht den neuen Standort (-1932) an der Bolleystrasse 1.
Die neue Bezeichnung lautet: "Post Zürich 13 Oberstrass". |
|
1897 |
Pakete bis 5 kg ohne
Wertangabe und ohne Nachnahme werden postintern nicht mehr einzeln registriert
und übergeben sondern summarisch registriert (Kartierung). |
|
1898 |
Aufhebung oder
Einschränkung des sonntäglichen Bahnpostdienstes auf Nebenlinien |
|
1898 |
Aufhebung der
sonntäglichen Briefvertragung in vielen Ortschaften der Schweiz |
| |
1898 |
Umzug der Hauptpost in das
fünfte Zürcher Posthaus, der heutigen Fraumünsterpost. Die Fraumünsterpost blieb
bis 1930 Hauptpost von Zürich. Anschliessend blieb sie bis heute als
Stadtfiliale erhalten. |
| |
1898 |
Ab 1. April 1898 wurde die
Zustellung für das Stadtgebiet zentral von der Zürcher Hauptpost aus
organisiert, der die bislang dezentralisierten Briefträger neu zugewiesen
werden. Die Paketträger verbleiben an den jeweiligen Aussenstellen. |
| |
1898 |
Brand
in der Zürcher Telefonzentrale an der Bahnhofstrasse am 2. April 1898. |
| |
1898 |
Umzug des Postbüros
Limmatquai an den Predigerplatz (spätere Post Mühlegasse). |
|
1899 |
Probehalber wird die
Paketvertragung an Sonn- und Feiertagen bei den grösseren Poststellen (Bureaux
I. und II. Klasse) eingestellt. |
| |
1899 |
Das Transitbüro wechselt
den Standort von der Beatengasse an die Seidengasse. |
| |
1899 |
Eröffnung der Poststelle
Selnau. |
| |
1899 |
In Zürich wird die erste
Haus-Rohrpostanlage in der Schweiz in Betrieb genommen. |
|
1900 |
Die ersten Sondermarken
der Schweiz erscheinen am 2. Juli 1900, anlässlich des Jubiläums 25 Jahre
Inkraftsetzung des allgemeinen Postvertrages. Die Marken stiessen bei den Kunden
nicht auf das erwartete Interesse. |
|
1900 |
Jeder Wehrmann verschickt
im Durchschnitt 6 Karten pro Tag. |
| |
1900 |
In der Stadt Zürich wird
die sechsmal tägliche Postzustellung eingeführt. Das heisst jeder Bote stellt
sechs mal am Tag in seinem Botenbezirk Sendungen zu. Wo bereits vorhanden,
dürfen die Boten das Tram benützen. |
| |
1900 |
In den Jahren 1850 bis
1900 wuchs das Zürcher Poststellennetz um weitere 13 Postbüros an und erreichte
somit einen Stand von total 27 Poststellen. |
|
1902 |
Die Paketzustellung an
Sonn- und Feiertagen wird eingestellt. |
|
1903 |
Der Postanweisungsdienst
erfährt starke Vereinfachungen |
|
1903 |
Einschränkung des
Schalterdienstes an Sonn- und Feiertagen auf drei Stunden vormittags. Anstelle
der bisherigen zwei Stunden am Vormittag und zwei Stunden am Nachmittag. |
|
1903 |
Einführung motorisierte
Fahrzeuge für den Posttransport |
| |
1904 |
Erster Motorfourgon der
Post in Zürich |
|
1904 |
Die ersten öffentlichen
Sprechstellen (Kassierstationen) entstehen |
|
1904 |
Neu werden auch Pakete
über 5 kg ohne Wertangabe und ohne Nachnahme postintern nicht mehr einzeln
registriert und übergeben sondern summarisch registriert (Kartierung). |
|
1905 |
Aufhebung der zweiten
Vorweisung bei Briefnachnahmen und Einzugsaufträgen |
| |
1905 |
Die Poststelle am
Kreuzplatz (Neumünsterpost) übersiedelt im Frühjahr von ihrem bisherigen
Standort am Kreuzplatz in das neu erstellte Wohnhaus an der Apollostrasse 2 /
Forchstrasse.
In diesem Wohnhaus war später nach dem Auszug der Post der Lebensmittelverein
und heute der Denner Discount eingemietet. |
|
1906 |
Am 6. Kongress des
Weltpostvereins wird die Einführung eines international gültigen Antwortscheines
beschlossen und am 1. Oktober 1907 als Rom-Muster realisiert. |
|
1906 |
Einführung des
Zahlungsverkehrs bei der Post |
|
1907 |
In Bern entsteht das
Postmuseum. |
|
1908 |
Pakete benötigen keine
zusätzlichen Anhängeetiketten mehr. Auf diese Art und Weise lassen sich jährlich
mehrere Millionen von Etiketten eingespart. |
|
1909 |
Gründung des
Bundesfeierkomitees am 16. Dezember 1909 in Bern. Der Verkauf der ersten
Bildpostkarten mit Wertzeicheneindruck, aus Anlass der schweizerischen
Nationalfeiertages, erfolgte ab 1910 bis 1937. |
|
1909 |
Alle Dienstabteilungen der
Bundesverwaltung müssen ihre Postsendungen beim Postbüro Bern 3 Bundeshaus
aufgeben. Das Personal dieses Postbüros frankierte die Sendungen und stellte
sodann monatliche Rechnungen für die einzelnen Abteilungen aus. Dieses System
blieb übrigens bis 1918 bestehen. |
|
1910 |
Ein Brief von Chiasso nach
Basel kostete 10 Rappen; gleichviel wie 1 kg Kartoffeln. |
| |
1910 |
Die Kreispostdirektion
sucht auf das Frühjahr 1911 im untern nordwestlichen Teil (Sihlfeld) des dritten
Stadtkreises geeignete Erdgeschossräumlichkeiten für Unterbringung einer neu zu
errichtenden Post- und Telegraphenaufgabestelle. Infolge der regen Bautätigkeit
längs der Badenerstrasse und im oberen Hardgebiet ist diese Massnahme zur
Notwendigkeit geworden. |
| |
1910 |
Die Gründung privater
Eilboten-Institute in Zürich, welche aus dieser Einrichtung ein eigentliches
Gewerbe machen, veranlasste die Kreispostdirektion, allgemein bekannt zu geben,
dass es auf Grund des Postgesetzes diesen Eilboten verboten ist, verschlossene
Briefe, Postkarten und überhaupt verschlossene Sendungen aller Art, welche das
Gewicht von 5 Kilogramm nicht übersteigen, zu befördern. Übertretungen werden
mit Geldbussen bis auf 2000 Franken (Bereits im Jahre 1910 !) bestraft. |
| |
1910 |
Hr. Richard Frei, Inhaber
des Pressbureau Richard Frei & Cie., hat das Unternehmen "Zürcher
Telephonanzeiger" an Hrn. Redakteur Ludwig Kaul in Zollikon verkauft. Hr.
Richard Frei besorgt aber wie bisher die redaktionelle Leitung des sich bereits
grosser Beliebtheit erfreuenden Telefonbuches. |
| |
1910 |
Vom 1. April an werden die
Postschalter an Samstagen und Tagen vor staatlich anerkannten Feiertagen, statt
erst um 8 Uhr (20 Uhr), schon um 7 Uhr (19 Uhr) geschlossen, was im Interesse
der geplagten Spediteure und Postangestellten nur zu begrüssen ist. |
| |
1910 |
Die Pöstler, dieses
vielbeschäftigte Völklein hatten am Sonntag den 5. Juni 1910 auch einmal einen
richtigen Freudentag. Schon sei langer Zeit sind unter den Angestellten der
eidgenössischen Post, Telegraph- und Zollverwaltung Postgesangsvereine gegründet
worden und es galt nun einmal einen gemeinsamen Schweizerischen Postsängertag zu
veranstalten. Diese Aufgabe hatte der Männerchor der Postangestellten von Zürich
übernommen. An diesem Anlass wurden um die 500 Sänger gezählt. |
| |
1910 |
Dieser Tage sind die neuen
Telephon-Verbindungen Zürich-Lugano II und Zürich-Altdorf in Betrieb gesetzt
worden. ferner sind die österreichischen Städte Bludenz (Vorarlberg) und Bozen
(seinerzeit noch Tirol) in den Verkehrsbereich der Telephonzentrale Zürich
einbezogen worden. Die Taxe für ein Gespräch von drei Minuten Dauer beträgt für
Zürich-Bludenz Fr.1.25, für Zürich-Bozen Fr. 2.40. |
| |
1910
Juli |
Als Postbureauchef in
Zürich ist Hr. August Steiner von Dürrenäsch (Kanton Aargau), Postkommis in
Zürich, gewählt worden.
Der Bundesrat hat als Postkommis in Zürich Hrn. Francesco Ferrari von Vaglio
(Tessin) ernannt. Dass der Bundesrat mit solchen Wahlen behelligt wird, ist ein
Zopf, der endlich einmal abgeschnitten werden soll. |
| |
1910
Sept |
Der Bau des neuen Postgebäudes in
Unterstrass, welches zwischen dem alten Gebäude und dem Gasthof "zur Sonne" zu
stehen kommt, ist in Angriff genommen worden. |
|
1911 |
Mit 1. Januar 1911 treten
in unserem Postverkehr eine grosse Anzahl Neuerungen ein, welche durch ein neues
eidgenössisches Postgesetz geregelt sind. Für Geschäfts- und Privatleute ist es
von Bedeutung, die teilweise recht einschneidenden Änderungen sofort kennen zu
lernen, und deshalb mag ihnen ein von einem beamten der Oberpostdirektion
verfasstes Büchlein, welches über die neue Postordnung kurz und zuverlässig
orientiert, sehr willkommen sein. Dasselbe ist eben beim Art. Institut Orell
Füssli in Zürich erschienen und wird gegen Einsendung von 30 Rappen an jeden Ort
der Schweiz franko gesandt. |
|
1911 |
Erste Tests und
anschliessende Einführung von Markenautomaten aus Deutschland. |
|
1911 |
Der Schalterdienst an
Samstagen wird von 20 Uhr neu auf 19 Uhr vorverlegt.
An Sonntagen wird der Schalterdienst auf zwei Stunden am Vormittag beschränkt. |
|
1911 |
Streichung der
Briefzustellung, Botendienste und Kastenleerungen am Sonntagnachmittag |
|
1912 |
Gründung der Stiftung "Pro
Juventute". Bereits im Dezember erscheinen die ersten Vorläufer der heute
bekannten Marken. Diese ersten Spendemarken waren noch ohne Frankaturwert. |
|
1912 |
Sackflaggen werden
endgültig im Sendungswechsel eingeführt |
|
1912 |
Einführung der ersten
Stempelmaschinen |
|
1913 |
Die ersten Eisenbahnmarken
der Schweiz werden per 1. März 1913 von der SBB als Frankaturmarken für eigens
transportiere Güter eingeführt. |
|
1913 |
Erstmals werden Postsachen
per Flugzeug transportiert |
|
1913 |
Die Post erwirtschaftete
mit einer Million Franken den kleinsten Betriebsgewinn seit 1892. Dieser Umstand
wurde durch mehrere Faktoren verursacht. So eröffnete die Post seit dem Jahre
1900 pro Jahr etwa 65 neue Poststellen. Ebenso wurde in grösseren Ortschaften
die Briefpost fünf- bis sechsmal am Tag, die Paketpost viermal am Tag,
zugestellt. Sogar in kleinen "unbedeutenden" Orten leistete sich die Post den
Luxus die Briefpost täglich viermal zustellen zu lassen. |
|
1913 |
Der Personalbestand
beträgt mittlerweile 16'758 Mitarbeiter (1900 noch 10'157) |
|
1913 |
Ausgabe der ersten Pro
Juventute Briefmarke mit Taxwert und Zuschlag (5+5 Rappen) |
| |
1913 |
Erfolgreicher Versuch mit
elektrischen Zustellfahrzeugen im Paketpostdienst in Zürich. |
| |
1913 |
In der Weihnachts- /
Jahresschlusszeit (20.-31. Dezember 1913) wurden durch die städtischen Postbüros
190'784 Pakete angenommen und 131'062 Pakete auf Stadtgebiet zugestellt. Die
Einnahmen beliefen sich dabei im gesamten Monat Dezember auf 638'978 Franken. |
|
1914 |
Drucksachen, Warenmuster
und Postkarten werden bei der Ankunft nicht mehr gestempelt |
|
1914 |
Reduktion der
sonntäglichen Schalteröffnung auf eine Stunde vormittags |
|
1914 |
Anpassung der
sonntäglichen Kastenleerungen. Eine Leerung bei kleinen und mittleren Stellen.
Bei grossen Dienststellen eine Leerung nachmittags oder abends. |
|
1914 |
Einstellung der Zustellung
von Drucksachen und Warenmuster am Sonntag |
| |
1914 |
In der Weihnachts- /
Jahresschlusszeit (20.-31. Dezember 1914) wurden durch die städtischen Postbüros
153'983 Pakete angenommen und 103'101 Pakete auf Stadtgebiet zugestellt. Die
Einnahmen beliefen sich dabei im gesamten Monat Dezember auf 488'723 Franken. |
|
1915 |
Erweiterung der
Postprodukte durch die Drucksachen ohne Adresse |
|
1915 |
Seit 1915 erscheinen
jeweils regelmässig im Dezember die "Pro Juventute" Marken |
| |
1915 |
In der Stadt Zürich, mit
Ausnahme der an der Peripherie liegenden Gebiete, werden die Briefschaften seit
1. April wieder viermal ausgetragen. Die Briefkastenleerungen finden jetzt in
dichter bevölkerten Quartieren wieder achtmal täglich statt, je mit direktem
Anschluss auf die Briefträgerabgänge und die wichtigsten Zugsgruppen. Vom 1. Mai
an werden die Postverbindungen nach auswärts durch Einrichtung vermehrter
Bahnpostkurse wiederum erhebliche Verbesserung erfahren. Quelle: Zürcher
Wochenchronik 24. April 1915
|
| |
1915 |
In der Weihnachts- /
Jahresschlusszeit (20.-31. Dezember 1915) wurden durch die städtischen Postbüros
201'948 Pakete angenommen und 127'662 Pakete auf Stadtgebiet zugestellt. Die
Einnahmen beliefen sich dabei im gesamten Monat Dezember auf 611'357 Franken. |
| |
1916 |
Seit dem Bestehen des
Postcheckdienstes ist der 30. Dezember 1916 zum Tage des höchsten Verkehrs in
den stadtzürcherischen Büros geworden. Es wurden an diesem Tage 849 Checks im
Betrage von 1'341'561 Franken einbezahlt. (Quelle: Zürcher
Wochen-Chronik vom 6. Januar 1917)
|
| |
1916 |
In der Weihnachts- /
Jahresschlusszeit (20.-31. Dezember 1916) wurden durch die städtischen Postbüros
191'943 Pakete angenommen und 129'458 Pakete auf Stadtgebiet zugestellt. Die
Einnahmen beliefen sich dabei im gesamten Monat Dezember auf 633'858 Franken. |
|
1917 |
Vom 20. Februar 1917 an
haben die Schweizerischen Poststellen abends um 7 Uhr Bureauschluss. Mittags
werden die Schalter von 12 bis 1 Uhr geschlossen. |
| |
1917 |
Im Zürcher Quartier
Hottingen wird die erste halbautomatische Telefonzentrale der Schweiz
in Betrieb genommen. |
|
1918 |
Am 25. Juli1918 werden die
ersten Marken mit dem Aufdruck "Industrielle Kriegswirtschaft" für
Dienstsendungen verwendet. |
|
1919 |
Erste provisorische
Schweizer Flugpostmarke mit einem Taxwert von 50 Rappen |
|
1919 |
Eröffnung der ersten
Flugpostlinie in der Schweiz Zürich-Bern-Lausanne am 30. April 1919 |
|
1919 |
Kurierdienst mit
Militärflugzeugen zwischen Bern und Dübendorf. Einstellung ebenfalls 1919. |
|
1919 |
Einführung des acht
Stunden Tages bei der Post per 1. August 1919 |
|
1920 |
Der Sitz des 1919
gegründeten Völkerbundes übersiedelt nach Genf.
Erste Wünsche nach Dienstmarken für die internationalen Organisationen werden
geäussert.
Eine erste Realisierung findet 1923 statt. |
|
1920 |
Internationale Anerkennung
der Frankiermaschine als Frankiermethode, anlässlich der Weltpostkonferenz im
spanischen Madrid |
|
1920 |
Aus Telefon, Telegraph und
Post entsteht die PTT unter gemeinsamer Leitung |
|
1920 |
Zusammenlegung der
Eilzustellung mit der Telegrammzustellung.
Vermehrt wurden Fahrräder, Elektromobile und Kleinautomobile eingesetzt. |
|
1920 |
Die sonntägliche
Briefzustellung wird per Ende Jahr in 2010 Orten eingestellt. |
|
1921 |
Die bisherigen
Flugpostmarken 50 Rappen und 30 Rappen verschwinden wieder und bleiben noch bis
zum 1. März 1923 gültig |
|
1921 |
Kongress des
Weltpostvereins in Madrid. Unter anderem werden die Einschränkungen für
Wohltätigkeitsmarken aufgehoben. Dies hat auch für die Schweiz und ihre "Pro
Juventute" Marken Auswirkungen. Bislang durften diese Marken im Auslandverkehr
nämlich nur für Sendungen nach Bayern, Dänemark, Italien, Portugal, Russland und
Ungarn verwendet werden. |
|
1921 - 1924 |
Zurückstufung von über 100
kleineren Filial- und Landpostämtern zu Bureaux |
| |
1922 |
Im Zürcher Quartier
Hottingen wird die erste vollautomatische Telefonzentrale der Schweiz
in Betrieb genommen. |
|
1922 |
Erste internationale
Fluglinie der Schweiz mit Luftpost von Genf - Zürich - Nürnburg. |
|
1922 |
Bis Ende Jahr wird in
weiteren 800 Orten die sonntägliche Briefzustellung eingestellt |
|
1922 |
Das erste Postauto fährt
über den Gotthardpass. |
|
1923 |
Für die internationalen
Dienststellen in Genf werden "Überdruckmarken" eingeführt.
Schweizer Wertzeichen werden mit einem zusätzlichen Aufdruck versehen und sind
sodann nur noch für diese Dienststellen verwendbar. |
|
1923 |
Am 1. März 1923 verlieren
die bisherigen, provisorischen Flugpostmarken ihre Gültigkeit. Gleichzeitig
erscheinen die ersten Exemplare der definitiven Ausgabe. |
|
1923 |
Die Postverwaltung verfügt
per 28. November 1923 die Gestattung von Frankiermaschinen |
|
1924 |
Die Sonntagszustellung
wird im Herbst 1924 definitiv aufgehoben |
|
1924 |
Aus Anlass des 50jährigen
Bestehens des Weltpostvereins werden kurzfristig zwei Sondermarken 20 Rappen
(rot; gedruckt bei der Landestopographie Bern) und 30 Rappen (blau; gedruckt von
Orell Füssli Zürich) herausgebracht. |
| |
1924 |
Der Radiosender Zürich
nimmt seinen Betrieb auf |
|
1925 |
Internationaler
Antwortschein
Ablösung des bisherigen Rom-Musters durch das Stockholmer-Muster |
|
1925 |
In der Schweiz hängen
bereits 11'043 gelbe Postbriefkästen (einer pro 355 Einwohner). |
|
1929 |
Internationaler
Antwortschein
Ablösung des bisherigen Stockholmer-Musters durch das Londoner-Muster |
|
1930 |
In der Schweiz sind
bereits 765 Marken- und 671 Postkartenautomaten in Betrieb. |
| |
1930 |
Eröffnung der Sihlpost |
|
1931 |
Erste amtliche
Postbeförderung per Rakete in Österreich am 9. September 1931 |
| |
1931 |
Eröffnung einer zweiten
Postfiliale im Quartier Fluntern (heutige Poststelle Zürichberg).
Der Standort befand sind damals an der Toblerstrasse 73 wo heute die Migros ist.
|
|
1932 |
Abrüstungskonferenz in
Genf. Ausgabe einer Schweizer Sondermarke durch Géo Fustier (Genf) die bei
Courvoisier in La Chaux-de-Fonds gedruckt wurde. |
|
1932 |
Brand in der Hauptpost
Bern am Bollwerk am 1. Mai 1932. Unter anderem wurde auch das Telegrammarchiv
ein Opfer der Flammen. Einzelne Telegrammen die nicht verbrannten, liess der
Wind durch die halbe Stadt flattern. Wo sie dann von Sammlern und Kindern gerne
aufgehoben und behändigt wurden. |
| |
1932 |
Die Poststelle Oberstrass
bezieht den noch heute aktuellen Standort im Rigihof an der Universitätsstrasse
101. |
| |
1934 |
Zweite Eingemeindung von
Zürcher Vororten zur Stadt: Affoltern, Albisrieden, Altstetten, Höngg, Oerlikon,
Seebach, Schwamendingen und Witikon. |
|
1936 |
Erster internationaler
Flug mit Postrakete am 2. Juli 1936 zwischen den beiden Städten Reynosa (Mexiko)
und McAllen (USA) |
|
1937 |
Das erste
Automobilpostbüro wird am 12. März 1937 am Automobilsalon in Genf in Betrieb genommen.
In der Deutschschweiz am 3. April 1937 anlässlich der Mustermesse Basel. |
|
1938 |
Die
Bundesfeier-Zuschlagsmarken lösen die bisherigen Bildpostkarten ab |
|
1939 |
Postbriefkästen und
Wertzeichenautomaten werden einheitlich und postgelb |
|
1941 |
Beim Eisenbahnunglück von
Kiesen verunglücken viele Passagiere und grosse Mengen von Postgut wird
vernichtet oder beschädigt. |
|
1944 |
Beim einem erneuten
Eisenbahnunglück, dieses mal in Wädenswil, verunglücken wiederum Passagiere und
grosse Mengen von Postgut wird vernichtet oder beschädigt. |
| |
1944 |
Die Neumünsterpost bezieht
neue Räumlichkeiten an der Forchstrasse 18. |
| |
1945 |
2. Juli 1945 Das Postamt
Heuried bezieht neuen Standort an der Birmensdorferstrasse 379. |
|
1947 |
Ausserkraftsetzung
bisheriger Dienstmarken der Société des Nations per 13. März 1947.
Schon bald erscheinen die ersten Dienstmarken der Nachfolgeorganisation
UNO. |
| |
1948 |
Eröffnung der Poststelle
8058 Zürich Flughafen am 14. Juni 1948. |
| |
1948 |
Eröffnung der Poststelle
8056 Zürich Wehntalerstrasse am 6. September 1948. |
|
1949 |
Das PTT-Museum entsteht
aus dem bisherigen Postmuseum |
| |
1949 |
Umzug des Postbüros
Predigerplatz am 1. April 1949 an die Mühlegasse. |
| |
1949 |
Eröffnung der Poststelle
8057 Zürich Hirschwiesen am 22. August 1949. |
|
1950 |
Der erste Auto-Briefkasten
wird montiert |
|
1950 |
Ein Brief von Chiasso nach
Basel kostete wieder 20 Rappen; gleichviel wie 0.5 kg Kartoffeln. |
| |
1950 |
Zwischen den Jahren 1900
und 1950 wuchs das Zürcher Poststellennetz um weitere 9 Filialen an. Somit gab
es nun in Zürich total 36 Poststellen. |
|
1951 |
Erste Konzession für
Fernsehempfang wird ausgestellt |
|
1952 |
Die
Bundesfeier-Zuschlagsmarken heissen fortan "Pro Patria" Marken |
| |
1952 |
Die Post bereitet am
Toblerplatz den Bau einer neuen Poststelle vor (8044 Zürich) vor:
Zu diesem Zweck kauft sie die alten Kueser-Häuser an der Toblerstrasse 76. |
| |
1954 |
Eröffnung der Poststelle
8059 Zürich Rieterplatz am 1. November 1954. |
|
1955 |
Die letzten Flugpostmarken
werden am 31. Dezember 1955 ausser Kurs gesetzt |
|
1958 |
Beim Eisenbahnunglück von
Lalden verunglücken viele Passagiere und grosse Mengen von Postgut wird
vernichtet oder beschädigt. |
| |
1959 |
Eröffnung der Poststelle
8044 Zürich im Neubau an der Toblerstrasse 76.
Gleichzeitig wird der alte Standort an der Toblerstrasse 73 aufgehoben. |
| |
1959-
1965 |
Bauarbeiten für das neue
Post- und Telefongebäude mit Garage in der Burgwies an der Forchstrasse 261. Das
Postgebäude wurde zweigeschossig erstellt und das Telefongebäude viergeschossig. |
| |
1960 |
Eröffnung der Poststelle
8061 Zürich Hirzenbach am 23. Mai 1960. |
| |
1960 |
Eröffnung der Poststelle
8060 Zürich Kalchbühl am 16. Dezember 1960. |
|
1961 |
Erste offizielle
Raketenpost in der Schweiz |
|
1961 |
Letzte Pferdepost wird in
Avers (GR) eingestellt |
|
1962 |
Ein neues
Nachnahmeverfahren wird eingeführt |
| |
1962 |
Eröffnung der Poststelle
8062 Zürich Waldgarten am 8. Oktober 1962. |
| |
1963 |
Am 1. April 1963 bezieht
das Postamt Zürich Heuried neue Räumlichkeiten an der Birmensdorferstrasse 419. |
|
1964 |
Einführung der
Postleitzahlen in der Schweiz
Originalfernsehbeitrag vom 10.
Juni 1964 im Schweizer Fernsehen "Antenne"
|
|
1964 |
Eröffnung des ersten
modernen Postzentrums der Schweiz in Lausanne. |
|
1965 |
Internationaler
Antwortschein
Ablösung des bisherigen Londoner-Musters durch das Wiener-Muster |
| |
1965 |
Wegen Kapazitätsengpässen
an freien Postfächern erhalten fünf der 42 Stadt-Postämter (Zürich 32, 34, 47,
50 und 52) mobile Postfachanlagen mit je 78 Fächern. In absehbarer Zeit sollen
weitere Filialen damit ausgerüstet werden (Zürich 28, 30, 37, 38 und 45). |
|
1967 |
Inbetriebnahme der ersten
Elektronischen Rechenzentrums und Aufhebung der Lochkarten. |
|
1968 |
Inbetriebnahme der ersten
automatischen Briefsortieranlage in der Berner Schanzenpost. |
| |
1969 |
Brand in
der Zürcher Telefonzentrale Hottingen am 22. Februar 1969. |
| |
1972 |
Eröffnung
Selbstbedienungs-Poststelle 8045 Zürich Friesenberg im 11. Februar 1972 |
| |
1973 |
Eröffnung
der Poststelle 8063 Zürich Triemlispital am 15. August 1973 |
|
1974 |
Internationaler
Antwortschein
Ablösung des bisherigen Wiener-Musters durch das Lausanner-Muster |
| |
1974 |
Eröffnung
Selbstbedienungs-Poststelle 8052 Zürich Birchhof am 11. November 1974 |
| |
1976 |
Eröffnung
der Poststelle 8064 Zürich Grünau am 17. Mai 1976 |
|
1978 |
Die ersten fünf Postomaten
werden in Betrieb genommen |
| |
1978 |
Eröffnung
der Poststelle 8065 Zürich TMC (Textil-Mode-Center) am 2. August 1978. |
|
1978 |
Inbetriebnahme des ersten
Natels (Autotelefon) |
|
1979 |
Der Schnellpostdienst EMS
entsteht |
| |
1984 |
Eröffnung der Poststelle
8091 Zürich Universitätsspital (Rämistrasse 100) am 4. Juni 1984. |
|
1984 |
Einführung des
garantierten Postcheques. |
| |
1985 |
Das Paketzentrum
Zürich-Mülligen nimmt seinen Betrieb auf. |
| |
1985 |
Eröffnung der Poststelle
8010 Zürich-Mülligen Annahme am 29. Mai 1985 |
|
1986 |
Es stehen mittlerweile 600
Bahnpostwagen im Einsatz. |
|
1989 |
Wiedereinführung der
Verzinsung von Postkontiguthaben |
| |
1991 |
Am 23. März 1991 schliesst
das Postamt 8032 Zürich Neumünster seine Schalter am bisherigen Standort an der
Forchstrasse 18 und bezieht ein
Provisorium an der Merkurstrasse 8. Der Bau an
der Forchstrasse wird abgerissen. |
|
1991 |
Lancierung der Postcard |
|
1992 |
Erweiterung der
Finanzdienstleitungen durch das Bundesfestgeld. |
|
1992 |
Erweiterung der
Finanzdienstleitungen durch die Herausgabe von Kreditkarten. |
|
1993 |
Erweiterung der
Finanzdienstleitungen durch das Jugend- und Ausbildungskonto, Railcard. |
| |
1994 |
Der Neubau der
Neumünsterpost wird an der Forchstrasse 8 bezogen. |
|
1994 |
Erweiterung der
Finanzdienstleitungen durch den Postcard-Railpass. |
| |
1995 |
Eröffnung
der temporären Poststelle 8079 Zürich Messe am 15. Januar 1995. |
|
1996 |
Erweiterung der
Finanzdienstleitungen durch Postphone. |
|
1997 |
Am 31. Dezember 1997 wird
die altehrwürdige PTT aufgelöst und in die beiden Bundesbetriebe "Swisscom AG"
und "Die Schweizerische Post" überführt. |
|
1997 |
Aus dem Zahlungsverkehr
PTT resp. Zahlungsverkehr Post wird die Postfinance |
|
1997 |
Einführung der ersten
Finanzdienstleistungen (Gelbe Fonds) |
|
1998 |
Einführung der Gelben
Lebensversicherungen und des E-Bankings (Yellownet). |
| |
1998 |
Zwischen 1950 und 1998
entstanden in der Stadt Zürich weitere 10 Poststellen.
Das Poststellennetz der Stadt Zürich verfügt nun über 46 Poststellen. Zusätzlich
existieren zu diesem Zeitpunkt drei weitere Poststellen die unter Zürich laufen,
sich aber nicht auf Stadtgebiet befinden. Es sind dies 8058 Zürich-Flughafen,
8065 Zürich-Textilmodezentrum und 8010 Zürich-Mülligen. |
| |
1998 |
Eröffnung
der Poststelle 8066 Zürich Letzipark am 24. August 1998. |
| |
1998 |
Per 1. Dezember 1998
erhalten die Institute des ETH-Zentrums die Postleitzahl 8092 |
| |
1998 |
Per 1. Dezember 1998
erhalten die Institute des ETH-Hönggerberg die Postleitzahl 8093 |
| |
1999 |
Schliessung der Poststelle
8059 Zürich Rieterplatz am 2. Oktober 1999. |
|
2000 |
Einführung des
E-Depositokontos und erste gestickte Briefmarke |
|
2001 |
Eröffnung von Postcenters
mit PostFinance-Beratungszonen.
|
|
2001 |
Erste Briefmarke mit
Schokoladenduft. |
|
2001 |
Die Post stellt pro Tag
ca. 18 Millionen Briefe zu, mehr als 1850 in einem ganzen Jahr. |
| |
|
|
Abbildung |
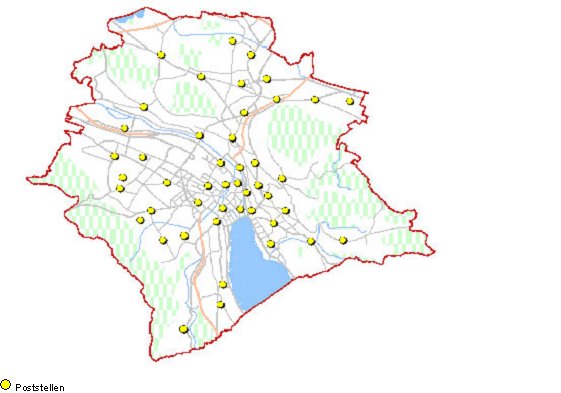 |
|
Bildtext |
Das Poststellennetz in der Stadt Zürich im Jahre
2001 |
|
Bildquelle |
Medienmitteilung
der Schweizerischen Post, Bern |
| |
|
| |
2003 |
Schliessung der Poststelle
8062 Zürich Waldgarten am 31. Mai 2003. |
|
2003 |
Erweiterung der
Finanzdienstleistungen mit Hypotheken für Privatkunden |
| |
2003 |
Schliessung der Poststelle
8010 Zürich Mülligen Annahme am 31. Oktober 2003. |
|
2003 |
Erweiterung der
Finanzdienstleistungen mit Kreditprodukten für Kantone und Gemeinden. |
| |
2003 |
Schliessung der Poststelle
8025 Zürich Mühlegasse am 31. Dezember 2003. |
| |
2003 |
Schliessung der
Selbstbedienungs-Poststelle 8052 Zürich Birchhof am 31. Dezember 2003. |
| |
2003 |
Schliessung der
Poststelle 8061 Zürich Hirzenbach am 31. Dezember 2003. |
|
2004 |
Liberalisierung des
Paketmarktes in der Schweiz per 1. Januar 2004. |
| |
2004 |
Schliessung der Poststelle
8056 Zürich Wehntalerstrasse am 31. Januar 2004. |
| |
2004 |
Schliessung der Poststelle
8043 Zürich Freilager am 20. April 2004. |
|
2004 |
Erweiterung der
Finanzdienstleitungen mit Krediten für kleine und mittlere Unternehmen. |
| |
2004 |
Schliessung der Poststelle
8060 Zürich Kalchbühl am 24. Dezember 2004. |
| |
2005 |
Schliessung der Poststelle
8028 Zürich Fluntern am 28. Januar 2005 |
| |
2005 |
Schliessung der Poststelle
8029 Zürich Hirslanden am 28. Januar 2005 |
| |
2005 |
Schliessung der
Selbstbedienungs-Poststelle 8045 Zürich Friesenberg am 31. März 2005. |
| |
2005 |
Schliessung der Poststelle
8091 Zürich Universitätsspital am 29. April 2005. |
| |
2005 |
Schliessung der Poststelle
8030 Zürich Hottingen am 30. Juli 2005 |
| |
2005 |
Eröffnung der Postagentur
8030 Zürich Hottingen am 2. August 2005 in der Hottinger-Apotheke an der
Freiestrasse. |
| |
2005 |
Umbau der Rämipost im 1.
Quartal. Wiedereröffnung nach kurzer Bauzeit am gleichen Standort. Es wird kein
Zahlungsverkehr mehr angeboten. |
| |
2005 |
Die Poststelle 8064 Zürich
Grünau übersiedelt von der Meierwiesenstrasse 54 an die Bändlistrasse 29. Neu
ohne Zahlungsverkehr. |
|
2005 |
Der Poststellennetzumbau
2001-2005 wurde erfolgreich abgeschlossen. |
| |
2006 |
Schliessung der Poststelle
8039 Zürich Selnau am bisherigen Standort an der Brandschenkestrasse 25 am 31. Mai 2006. |
| |
2006 |
Eröffnung der Poststelle
8039 Zürich Selnau am neuen Standort Bleicherweg
am 1. Juni 2006. Es wird neu kein Zahlungsverkehr mehr angeboten. |
| |
2006 |
Schliessung der Poststelle 8055 Zürich
Heuried per 30. September 2006. |
| |
2007 |
Inbetriebnahme des Briefzentrums
Zürich-Mülligen. |
| |
2007 |
Schliessung der Poststelle
8023 Zürich Hauptbahnhof per Ende Jahr wegen Vorarbeiten zum neuen Bahnhof
Löwenstrasse. Keine Ersatzmöglichkeit gefunden. Es wird auf die nahe Sihlpost
umbasiert welche bei Bedarf die Schalter- und Postfachangebote ausbauen wird. |
| |
2008 |
Schliessung der neuen
sowie grossen Teilen der alten Sihlpost. Im Altbau der Sihlpost verbleibt nur
der Annahmebereich (Postschalter) sowie die Postfächer. |
| |
|
|
|
|
|
Abbildung |

 |
|
Bildtext |
Eingang zur Rämipost mit wartenden Hunden im Jahre 1950
und die alte Rämipost an der
Rämistrasse auf einer Ansichtskarte um das Jahr 1900. |
|
Bildquelle |
Museum für Kommunikation, Bern |
| |
|
|
|
Links zum
Thema |
|
| |
|
Wir übernehmen keine Haftung
für die Inhalte auf den angegebenen Webseiten |